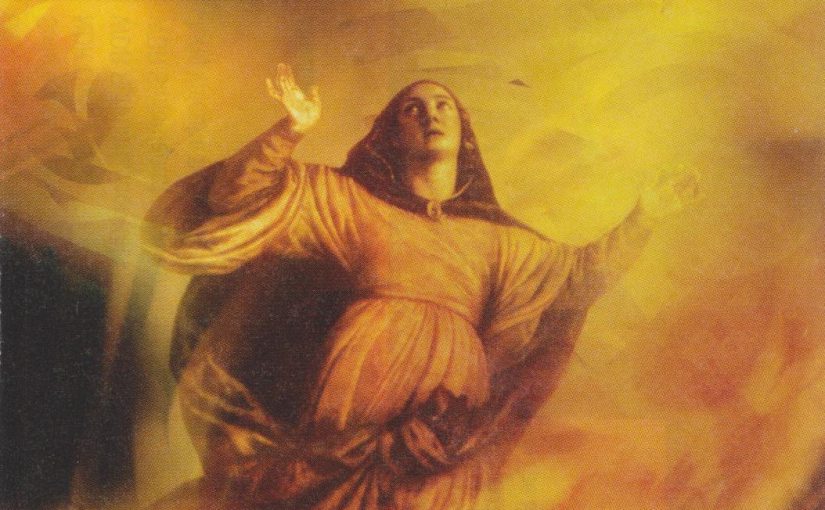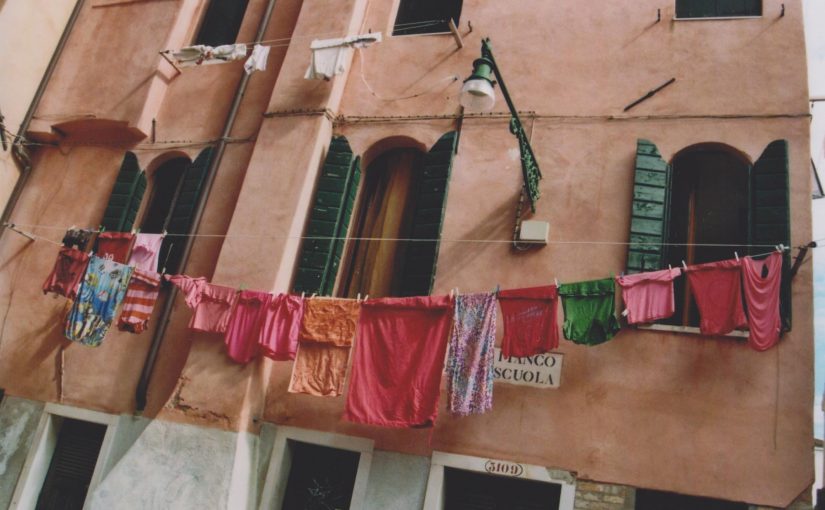“Wenn einem ein Licht aufgeht”
Jetzt fragt man sich, wie kommen manche Leute dazu, Straßenlaternen zu fotografieren ?
Tja, fotografieren kann man natürlich alles, aber was macht den Reiz aus, eine Straßenlaterne zu fotografieren ?
Bei Türen kann man das ja noch verstehen, denn eine Tür ist ja ein Ursymbol des Lebens, Ein- und Ausgänge, drin – draußen, Verbindungen von draußen nach drinnen…
Straßenlaternen dienen ja eher der Beleuchtung, damit man im Dunkeln den Weg findet.
Tja, das ist aber nur die oberflächliche Bedeutung… Beleuchtung ist alles weiterlesen