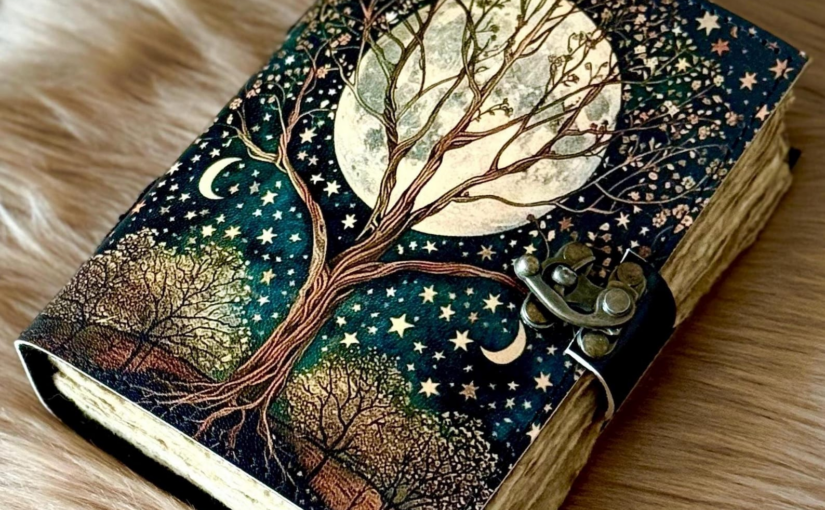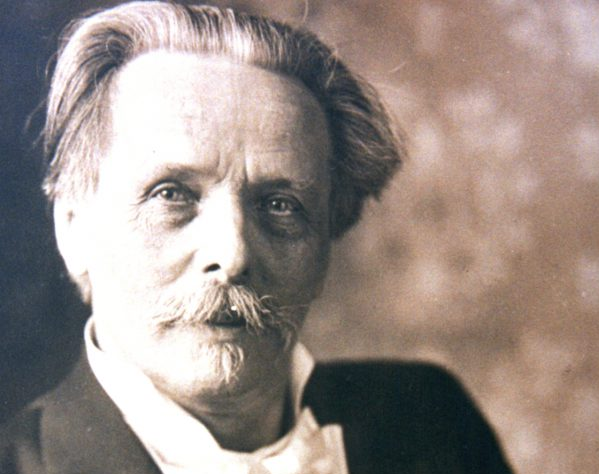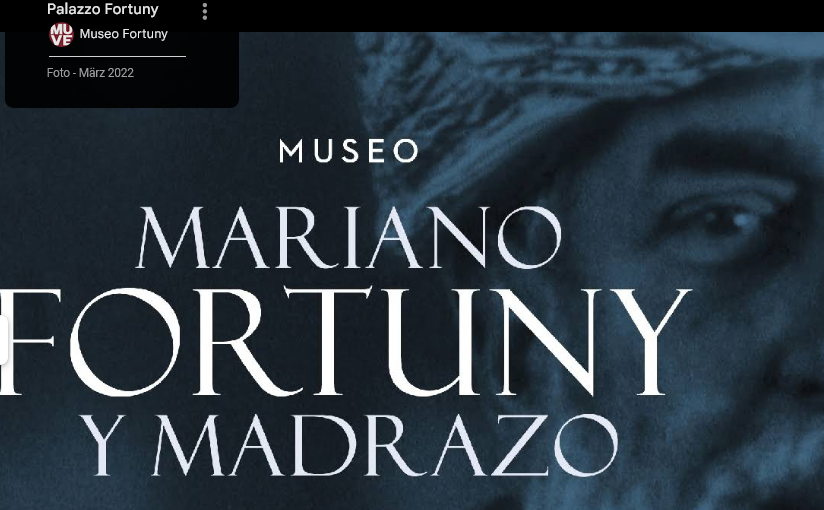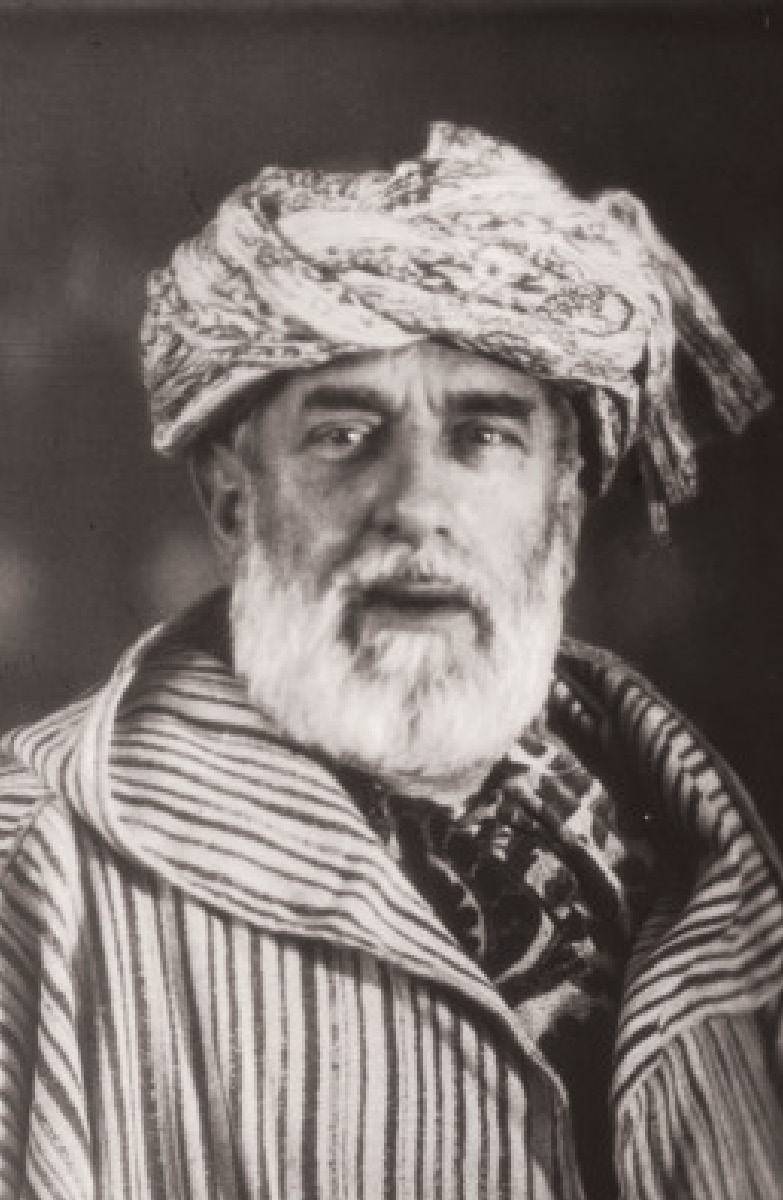“Von einem, der da war und einem, der nicht da war”
Mitte des 18 Jahrhunderts war das Rauchen von Opium sehr aktuell und beliebt, es gab auch keine oder wenige gesetzliche Einschränkungen oder Verbote.
Neben dem Einsatz als Schmerz- und Schlafmittel spürte man nach kurzem Konsum auch seine rauschbringende Wirkung.
Man merkte im frühen Stadium bei Personen, die Opium konsumierten, eine gesteigerte Arbeitsbereitschaft und eine Veränderung des Gemütszustandes.
Was soll daran negativ sein (?) – im Gegenteil.
Man wusste damals allerdings noch nichts von den gesundheitlichen Folgeschäden.
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Apathie, Muskelschmerzen, Atemlähmungen oftmals mit Todesfolge … ganz zu schweigen von starken Suchterscheinungen.
Da sieht die ganze Sache schon anders aus.
Deshalb fällt Opium unter das Betäubungsmittelgesetz, d.h. dass der Vertrieb heute illegal ist.
Dies treibt natürlich den Preis auf dem Schwarzmarkt in die Höhe und das Geschäft blüht. Produktionsländer und Anbau gibt es vor allem in Mittel-Amerika, im Nahen Osten, der Türkei und Vietnam, Thailand etc.
Höchstens als gesundheitliches Heilmittel zur Unterdrückung von starken Schmerzen kann es in Ausnahmefällen noch ärztlich verschrieben werden.
Die Wirkung hält meistens mehrere Stunden an und der Konsum hat entspannt-hypnotische oder narkoseähnliche Zustände als Folge, negative Gefühle werden automatisch ausgegrenzt und es wirkt stark betäubend und beruhigend.
Entspannte Euphorie und Hochstimmung nehmen zu.
Die negativen Langzeitschäden lassen auch durch den Suchtfaktor jedem klar werden, dass die ganze Euphorie bald ein Ende hat, von kontinuierlichen finanziellen Ausgaben ganz zu schweigen, denn es kommt schnell der unüberwindliche Wunsch nach der nächsten Pfeife.
Opiumhöhlen in Istanbul weiterlesen