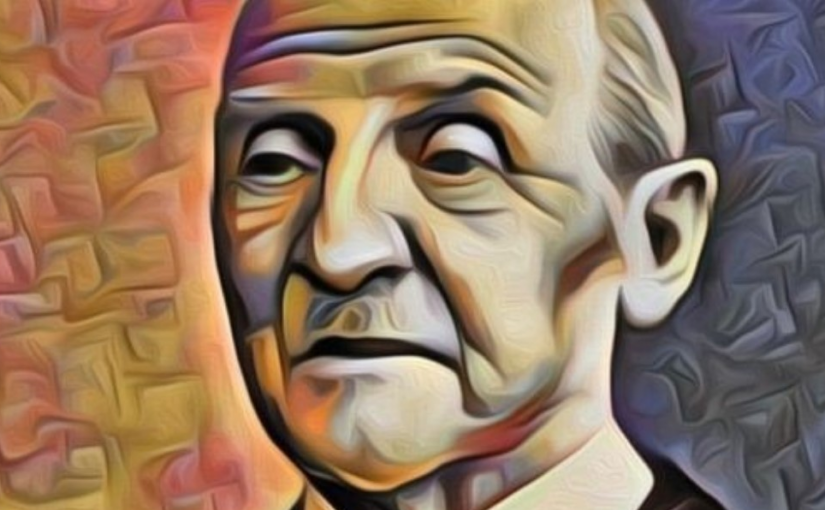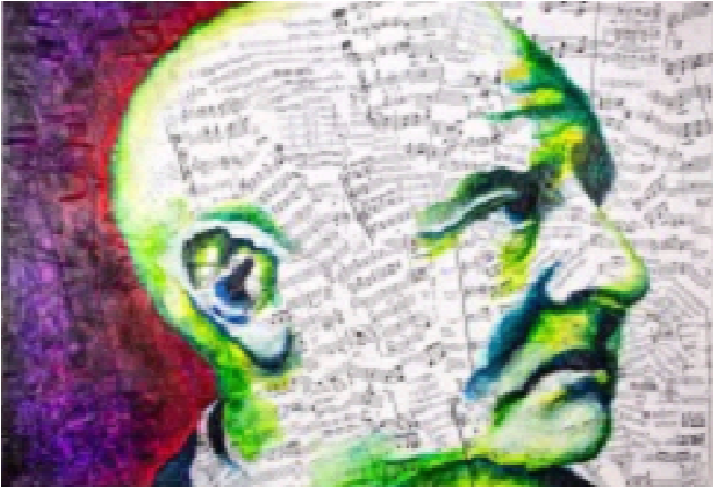“Adelson e Salvini”
Sogenannte Frühwerke haben ja den Vorteil, dass sie nicht jeder kennt.
Das, was jeder kennt, verliert irgendwann seinen Reiz, egal, ob es eine Oper, ein Musikwerk oder ein Roman ist.
Wenn man sich nun für die Werke des Schöpfers (Bellini) begeistert, dann kennt man natürlich “Norma”, “I Capuleti e i Montecchi”, “I Puritani”, “La sonnambula” oder “Il pirata”.
Man muss immer bedenken, dass die Werke großer Komponisten der Programmmusik immer daran zu messen sind, was nach dem Ableben des Schöpfers noch aufgeführt wird.
VINCENZO BELLINI (1801–1835) hat in seinem kurzen Leben 10 Werke geschrieben, von denen heute noch 5–6 auf den Bühnen der Welt aufgeführt werden, was eine ungeheure Leistung darstellt.